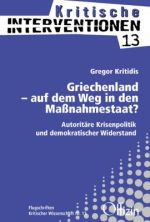|
136 Artikel in der Kategorie "Theorie": Seite: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
(136 Aufsätze)
 Marcus Hawel, Vom großen Globalisierungsbetrug. Oskar Negts neues Buch "Arbeit und menschliche Würde" (März 2002) Marcus Hawel, Vom großen Globalisierungsbetrug. Oskar Negts neues Buch "Arbeit und menschliche Würde" (März 2002)
Das neue Buch von Oskar Negt über "Arbeit und menschliche Würde" ist eine intellektuelle wie politische Herausforderung. Seine Überlegungen sind, so schreibt er selbst, "das Ergebnis einer mehr als zwei Jahrzehnte umfassenden, durch Bruchstellen, Niederlagen und Erfolge in gleicher Weise gekennzeichneten Kampfsituation." Es ist mit seinen fast 750 Seiten etwas dicker ausgefallen als wohl ursprünglich beabsichtigt, aber es ist nicht nur deswegen ein starkes, vielgesichtiges Buch, das mithin auch den Titel "Vom großen Globalisierungsbetrug" hätte tragen können, oder: "Bausteine für eine Ökonomie des Gemeinwesens". Die Bausteine legt Oskar Negt in fünf Kapiteln vor, von denen jedes soviel brisanten Zündstoff enthält, daß es sich die regierenden Sozialdemokraten vermutlich nicht wagen werden, es zu lesen.
(1 Kommentar)
 Hermann Klenner, Jedem das Seine! Geschichte eines Schlagworts. (Februar 2002) Hermann Klenner, Jedem das Seine! Geschichte eines Schlagworts. (Februar 2002)
Überliefert seit zweieinhalb Jahrtausenden, ist Jedem das Seine! zu einem der dienstältesten Schlagworte der Welt geworden. Zudem ist es infolge der Weltgeltung gleicherweise griechischer Philosophie wie römischen Rechts in seiner lateinischen Ursprungsversion Suum cuique! über viele Ländergrenzen hinweg verbreitet. Man verwendet es zuweilen schablonenhaft, also ohne sich dabei überhaupt etwas zu denken, und jedenfalls nichts Allgemeingültiges. Oder mit einem banalen Hintergedanken, etwa: »Jedem das Seine, und mir ein bißchen mehr!« Unmißverständlich ist der Sinn von Jedem das Seine! jedenfalls nicht. Doch ist ohnehin nicht die Eindeutigkeit, sondern die Deutungsvielfalt intelligenter Sätze das Normale. Schon deshalb, weil sich der geistige Gehalt eines Textes ohne dessen jeweiligen Kontext nicht erschließen läßt. Und dieser wandelt sich wie alles in der Welt; rascher jedenfalls als Worte, die versteinerten Gedanken. Worten wohnt kein Begriff inne. Es sind die Menschen, die etwas bezeichnen und begreifen – oder auch nicht!
(16 Kommentare)
 Oliver Heins, Freie Software - eine Gegen-Ökonomie? (Januar 2002) Oliver Heins, Freie Software - eine Gegen-Ökonomie? (Januar 2002)
Freie Software - so die Generalthese des Autors - ist als ein Phänomen von modernen Klassenauseinandersetzungen zu begreifen, die imstande sein könnten, die auf Eigentum zentrierte kapitalistische Ökonomie der Gegenwart sozialistisch zu transformieren. Copyright und Patentrecht stehen dem als Fesseln einer allgemeinen Produktivkraftentwicklung auf qualitativ erweiterter Stufenleiter entgegen, weshalb sich die Klassenkämpfe der Zukunft gegen diese Fesseln richten könnten. Den populärsten Ausdruck freier Software stellt das Betriebssystem Linux dar.
(18 Kommentare)
 Marcus Hawel, Abbruch der Dialektik - Die Geburt des bürgerlichen Staates. Zur Kritik der Rechtsphilosophie Hegels (Dezember 2001) Marcus Hawel, Abbruch der Dialektik - Die Geburt des bürgerlichen Staates. Zur Kritik der Rechtsphilosophie Hegels (Dezember 2001)
Die Staats- und Rechtsphilosophie Hegels, wie sie in ihrer Form von 1821 als "Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse" am meisten entfaltet vorlag, war das Ergebnis einer Begriffsarbeit des Philosophen, der als "Sohn seiner Zeit" die Veränderungen in der außerbegrifflichen Wirklichkeit in Gedanken zu fassen suchte. In dieser begrifflichen Entwicklung der "Rechtsphilosophie" Hegels lassen sich einige Etappen sichtbar machen.
(1 Kommentar)
 Erik Borg, Steinbruch Gramsci. Hegemonie im internationalen politischen System (Oktober 2001) Erik Borg, Steinbruch Gramsci. Hegemonie im internationalen politischen System (Oktober 2001)
Die Kritik der neoliberalen Globalisierung folgt häufig der Vorstellung vom »Sieg des Marktes über den Staat«. Gegen diese Verkürzung wendet sich die Internationale Politische Ökonomie - eine Theorieschule, die an Antonio Gramsci und dessen Hegemoniebegriff anknüpft. Dieser betont den sozialen Konsens als Voraussetzung von Herrschaft. Das gilt auch für die internationale Politik, in der zivilgesellschaftliche Akteure an Bedeutung gewinnen. Die Übertragung der auf den Nationalstaat bezogenen Terminologie Gramscis auf die globale Ebene hat jedoch Probleme, ihre eigenen Ansprüche einzulösen.
(0 Kommentare)
Seite: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
(136 Aufsätze)
 |